Wenn die Angst das Ruder übernimmt – Angst bewältigen bei Überforderung
 Angst bewältigen bei Überforderung ist oft leichter gesagt als getan. Denn manchmal kommt sie einfach über uns. Wird ausgelöst, durch einen Gedanken, ein Geräusch, einen Satz. In solchen Momenten erleben viele Menschen, wie schwer es ist, Angst zu bewältigen, denn das Herz rast, die Gedanken jagen einander, und das Bedürfnis, sich dem allen zu entziehen, wird übermächtig. Der Kopf wird laut, der Atem wird flach, und ein alter, vertrauter Reflex übernimmt: „Ich halte das nicht aus, ich muss hier weg.“ Alles in uns sträubt sich gegen diesen Zustand, wir wollen ihn nicht, weil er uns erschöpft und scheinbar infrage stellt.
Angst bewältigen bei Überforderung ist oft leichter gesagt als getan. Denn manchmal kommt sie einfach über uns. Wird ausgelöst, durch einen Gedanken, ein Geräusch, einen Satz. In solchen Momenten erleben viele Menschen, wie schwer es ist, Angst zu bewältigen, denn das Herz rast, die Gedanken jagen einander, und das Bedürfnis, sich dem allen zu entziehen, wird übermächtig. Der Kopf wird laut, der Atem wird flach, und ein alter, vertrauter Reflex übernimmt: „Ich halte das nicht aus, ich muss hier weg.“ Alles in uns sträubt sich gegen diesen Zustand, wir wollen ihn nicht, weil er uns erschöpft und scheinbar infrage stellt.
Angst gehört zu den Emotionen, die in unserer Gesellschaft keinen guten Ruf haben. Wir wollen sie nicht spüren, weil sie uns das Gefühl gibt, schwach, hilflos oder nicht belastbar zu sein. Viele von uns haben früh gelernt, ihre Angst zu verstecken oder zu überspielen, durch Kontrolle, Aktionismus oder durch rationale Erklärungen. Das Paradoxe daran: Genau das hält die Angst fest. Denn was wir vermeiden, kann sich nicht verwandeln. Obwohl das so einfach und logisch klingt, ist es komplexer.
Im Verlauf meines Lebens habe ich mich vielen Ängsten gestellt, und das gelang mir unter zwei Voraussetzungen:
1. Ich stand so sehr mit dem Rücken an der Wand, dass mir alles egal war, ich hatte nichts mehr zu verlieren. In dem Moment, in dem ich das akzeptierte, ließ ich die Angst los und konnte schonungslos betrachten, wie die Situation gerade wirklich ist.
2. Ich fühlte mich sicher genug, mir anzuschauen, was los ist.
In diesem Beitrag erläutere ich dir die Mechanismen, die der Angst in dir die Tür öffnen, und zeige dir am Ende ein paar Wege, die Auswege aus dem Zustand der Angst sein können.
Was dich in diesem Beitrag erwartet:
- Ein persönlicher Gedanke vorab
- Wie Angst entsteht – und warum sie sich aufbaut
- Warum Gedanken Angst verstärken können
- Die Angst vor der Angst verstehen
- Angst und Sicherheit – was dein Körper wirklich braucht
- Wenn Angst plötzlich auftritt: Trigger und alte Schutzreflexe
- Warum du in alten Mustern reagierst
- Angst oder Panik? Der feine Unterschied
- Wie du Angst bewältigen und Panik beruhigen kannst
- Du musst deine Angst nicht allein tragen
Ein persönlicher Gedanke vorab
Ich erlebe diese Momente, in denen die Angst übernimmt, in meiner Arbeit immer wieder. Häufig taucht in diesen Situationen der Gedanke auf: „Ich muss in die Klinik.“ Dies ist besonders bei Menschen so, die schon einmal in der Klinik waren. Nicht weil es dort so schön ist, sondern weil die Klinik ein geschützter Raum ist, in dem jemand anderes die Verantwortung trägt. In solchen Angstphasen wird die Klinik zu einem Ort, der Sicherheit bietet, wenn das Leben draußen zu viel wird. Allerdings ist der Gedanke an die Klinik häufig verbunden mit dem Gefühl, zu versagen, es wieder einmal nicht geschafft zu haben.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass diese beiden Stimmen den Angstzustand verschärfen, weil ich immer nur einem Bedürfnis glaube: Entweder dem nach Sicherheit im geschützten Raum (Klinik) oder dem nach eigener Kraft. „Wenn ich mich nur genug anstrenge!“ Der Ausweg liegt darin, beide Bedürfnisse anzunehmen – sie nicht als Gegensätze zu verstehen, sondern als zwei Bedürfnisse, die sich in dir zeigen: Sicherheit und Selbstwirksamkeit. Sie müssen keine Feinde sein, denn beide wollen dich und dein Leben schützen.
Entscheidest du dich für die Klinik, entscheidest du dich für Sicherheit und bist dennoch selbstwirksam, denn es ist deine Entscheidung. Sicherheit braucht Stabilität, und dabei wirst du in der Klinik unterstützt. Bist du stabil, kannst du dich um die Erweiterung deines Sicherheitsgefühls in dir, in deinen Räumen, Beziehungen oder in Coaching und Therapie kümmern. Auch hier entscheidest du dich für Selbstwirksamkeit, indem du aktiv für deine Sicherheit sorgst.
👉 Bitte beachte: Wenn die Klinik der allerletzte Ausweg ist, dann geh in die Klinik. Stabilisiere dich dort. Und wenn du wieder raus bist, arbeite weiter an dem, was dir fehlt: Sicherheit. In diesem Fall ist der Gang in die Klinik kein Versagen, sondern ein Akt der Selbstfürsorge.
Wie Angst entsteht – und warum sie sich aufbaut
Angst kommt in den meisten Fällen nicht plötzlich, sie wächst in uns heran. Ihre ersten Anzeichen nehmen wir wahr als ein diffuses Unwohlsein, eine innere Spannung, die kaum zu greifen ist. Der Körper sendet erste Signale: Mal leiden wir unter Schlafstörungen, Muskelanspannung oder erhöhter Reizbarkeit. Häufig zeigt sich dies zusammen mit dem Bedürfnis nach Rückzug. Doch weil vieles davon vertraut ist und sich in einem stressigen Alltag immer wieder einmal zeigt, bemerken wir nicht, dass unser System längst auf Anspannung läuft.
Der Körper reagiert, weil etwas in dir, oft ein jüngerer, verletzlicher Anteil, das Gefühl hat, allein, überfordert oder schutzlos zu sein. Etwas in dir, dein Körper, deine Seele, vielleicht ein jüngerer Anteil von dir, also dein komplettes System, sehnt sich nach Halt und Sicherheit.
Wie und warum sich Angst in uns aufbaut und was das mit fehlender Sicherheit und Gedanken, die uns auf falsche Wege locken, zu tun hat, erläutere ich dir in diesem Abschnitt.
Warum Gedanken Angst verstärken können
Angst entsteht, wenn unser Nervensystem zu lange in einem Zustand der Überforderung verweilt. Das kann körperliche, emotionale oder soziale Ursachen haben: zu viel Verantwortung, zu wenig Ruhe, ungelöste Konflikte, anhaltender Stress und fast immer: zu wenig Zeit, achtsam und fürsorglich mit uns selbst umzugehen. Wir trimmen uns aufs Funktionieren, während unser System (Körper und Psyche) nach Sicherheit sucht. Wenn es diese nicht findet, bleibt es in einer Art Wachsamkeitsmodus hängen. In diesem Zustand reagiert der Körper auf kleinste Signale mit Alarm: erhöhter Herzfrequenz, flachem Atem, Anspannung im Bauchraum. Während der Körper unruhiger wird, versucht der Verstand, den Alarmzustand des Körpers zu erklären. Er sucht nach einer Ursache und greift dabei auf frühere Erfahrungen zurück, auf alte Erinnerungen, Überzeugungen und Szenarien, die sich einst eingeprägt haben.
Das bedeutet, der Verstand
- „scannt“ nach vergangenen Situationen, in denen wir uns ähnlich fühlten.
- greift auf alte Überzeugungen zurück, wie: „Ich bin nicht sicher“, „Ich darf keine Fehler machen“, „Ich halte das nicht aus“.
- aktiviert erlernte Denkbahnen, also das, was in früheren Krisen „Sinn ergab“.
So entstehen Gedanken, die vertraut klingen, aber aus der Vergangenheit stammen. Das heißt, der Kopf erzählt Geschichten, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Doch diese Geschichten spiegeln nicht die Gegenwart, sondern das, was einmal war. Diese Gedanken sind also Versuche, Körperempfindungen in Bedeutung zu übersetzen, und das auf der Grundlage alter Erfahrungen. Sie sollen Orientierung schaffen, erzeugen aber meist neue Unsicherheit, weil sie aus einem überforderten Zustand heraus entstehen. Das Denken spiegelt, was der Körper fühlt, auch wenn das, was wir in diesen Momenten denken, unter Umständen nur wenig mit unserer aktuellen Realität zu tun hat. Doch weil wir gelernt haben, inneren Zuständen zu misstrauen, glauben wir den Gedanken mehr als unseren Empfindungen. Damit übernehmen die Gedanken das Kommando und aus der Anspannung wird Angst.
Die Angst vor der Angst verstehen
Viele Menschen fürchten nicht nur die Angst selbst, sondern auch ihr Wiederkehren. Schon der Gedanke an einen möglichen Angstanfall kann das Nervensystem aktivieren. Der Körper erinnert sich an eine ähnliche frühere Überflutung und reagiert, als stünde sie unmittelbar bevor. So entsteht eine zweite Angst, die nichts mit einer realen Bedrohung zu tun hat, sondern mit der Erinnerung an einen Kontrollverlust.
Vor diesem erneuten Kontrollverlust oder Ohnmachtsgefühl will der Körper sich schützen. Und der Verstand hilft dabei, auf seine Weise. Er beginnt, mögliche Gefahren zu durchdenken, will vorbereitet sein, will verhindern, dass „es wieder passiert“. Diese Gedanken wirken scheinbar rational: „Was, wenn ich wieder Panik bekomme?“ „Ich darf mich nicht öffnen, sonst werde ich wieder verletzt.“ Doch genau diese Versuche, Kontrolle zu behalten, halten das Nervensystem in Alarmbereitschaft. Der Kopf wird zu einem Wächter, der ständig nach Anzeichen von Gefahr sucht und sie dadurch selbst erschafft. Je mehr wir versuchen, Angst zu vermeiden, desto sensibler reagiert unser System auf jede körperliche Veränderung: einen schnelleren Puls, einen Druck in der Brust, ein Schwindelgefühl. Was im Grunde harmlos ist, wird als Vorbote der Panik gedeutet und der Kreislauf beginnt von vorn.
Die Angst vor der Angst ist keine Schwäche, sondern ein Überlebensreflex, der zu stark geworden ist. Erst wenn wir anerkennen, dass auch diese Angst uns schützen will, kann sich der Körper beruhigen. Die Angst verliert ihre Macht über uns, wenn wir sie nicht mehr bekämpfen, sondern wahrnehmen: „Da ist sie wieder.“ Ist das leicht? Keineswegs. Denn manchmal führt uns der Weg durch die Angst genau zu den Emotionen, die wir so gern vermeiden wollen. Ein uralter Schmerz, der sich lösen kann, wenn wir ihn fühlen.
Angst und Sicherheit – was dein Körper wirklich braucht
Angst ist meiner Ansicht nach das direkte Gegenteil von Sicherheit. Sie zeigt an, dass unser System innerlich oder äußerlich keinen Halt mehr spürt. Manchmal fehlen äußere Faktoren wie Schlaf, Struktur oder soziale Unterstützung. Manchmal fehlt aber auch die innere Sicherheit: das Vertrauen, mit sich selbst verbunden zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Hinter dieser Unsicherheit liegt oft etwas Tieferes, ein alter Schmerz, den wir früher nicht fühlen durften, weil er zu groß war. Wenn die innere Sicherheit fehlt, versucht die Angst, uns vor genau diesem Schmerz zu schützen. Sie hält uns davon ab, etwas zu berühren, das damals unerträglich gewesen wäre, etwa die Erfahrung von Verlassenheit, Hilflosigkeit, Nicht-Gesehen-Werden.
Kinder, die unsichere oder ambivalente Bindung erfahren haben, mussten lernen, sich innerlich abzuspalten, um zu überleben. Ein Teil in ihnen blieb wachsam, immer auf der Suche nach Sicherheit, die früher nie ganz zuverlässig gewesen ist. Diese frühe Wachsamkeit lebt im erwachsenen Körper weiter: als Angst, Unruhe, Überkontrolle oder in dem Gefühl, nie wirklich zur Ruhe zu kommen.
Die Angst will uns oft gar nicht lähmen, sie will uns bewahren. Sie will verhindern, dass wir uns wieder so fühlen müssen wie damals, als niemand da war, als unsere Emotionen unerwünscht waren, als die Erwachsenen es mit uns nicht ausgehalten haben. Doch was uns als Kind schützte, steht uns als Erwachsenen im Weg: Die Angst schützt heute vor einem Schmerz, den wir längst überlebt haben.
Je länger die Unsicherheit anhält, desto mehr sucht unser System nach Orientierung. Dann reicht manchmal ein kleiner Reiz, ein Konflikt, eine Veränderung oder ein unvorhergesehenes Ereignis, und das Nervensystem kippt in den Überlebensmodus und sendet Angstsignale. Damit will es dich nicht zerstören, sondern warnen: Da war einmal etwas, das zu viel für dich war, und ich will, dass du diesmal sicher bleibst.
Wenn Angst plötzlich auftritt: Trigger und alte Schutzreflexe
Manchmal geschieht das innerhalb von Sekunden. Ein Geräusch, ein Geruch, ein bestimmter Blick, und dein System erkennt darin unbewusst eine frühere Bedrohung. Es spielt keine Rolle, ob sie real ist oder nur erinnert: Der Körper reagiert, als wäre sie jetzt.
Angst ist in ihrem Ursprung ein Schutzmechanismus. Sie sorgt dafür, dass wir aufmerksam werden, reagieren und uns in Sicherheit bringen. Sie warnt uns, wenn etwas bedrohlich ist, und rettet uns, wenn Gefahr tatsächlich besteht. Doch bei einem Nervensystem, das traumatische Erfahrungen gemacht hat, ist dieser Schutzmechanismus überempfindlich geworden.
Ein traumatisiertes Nervensystem ist eines, das zu oft Gefahr erlebt hat, ohne danach wieder in Ruhe zurückzufinden. Es hat gelernt, lieber einmal zu viel Alarm zu schlagen als einmal zu wenig. Darum können heute Reize, die objektiv betrachtet harmlos sind, starke Angstreaktionen auslösen. Ein bestimmter Geruch, ein Tonfall, ein Schatten, eine Berührung – all das kann als Trigger wirken, weil das System in diesen Reizen etwas erkennt, das an eine frühere Bedrohung erinnert.
Die Amygdala, das Angstzentrum im menschlichen Gehirn, reagiert blitzschnell. Sie schaltet auf Alarm, Adrenalin wird ausgeschüttet, das Herz schlägt schneller, der Atem beschleunigt sich. Das Denken wird flach, der Blick verengt sich und der Körper bereitet sich auf Flucht oder Erstarrung vor. Auch diese plötzliche Angst ist keine persönliche Schwäche, sondern ein Reflex, ein Schutzprogramm, das dir einst das Überleben gesichert hat. Obwohl heute die Gefahr vorbei ist, ist die Angst in deinem System noch gespeichert. Und weil dein Schutzprogramm Sicherheit über alles stellt, löst es lieber einmal zu viel Alarm aus als einmal zu spät.
Warum du in alten Mustern reagierst
Auch wenn wir längst erwachsen sind, arbeitet unser Nervensystem nach Erinnerung, nicht nach Kalenderjahren. Wenn eine Situation heute dieselben inneren Zustände hervorruft wie damals – Ohnmacht, Überforderung, Kontrollverlust –, reagiert das System, als wäre es wieder dort. Das geschieht unbewusst. Der Körper erinnert sich an „Gefahr“ und der Kopf, treu wie immer, liefert sofort eine Geschichte dazu.
Unser Nervensystem hat einen bestimmten Bereich, in dem es sich reguliert und flexibel bleibt, das sogenannte Window of Tolerance, das „Fenster der Toleranz“. Solange wir uns in diesem Fenster bewegen, können wir Stress, Emotionen und Herausforderungen gut verarbeiten. Wir spüren Anspannung, bleiben aber handlungsfähig, können klar denken, fühlen und atmen. Werden alte Erinnerungen aktiviert oder kommen neue Belastungen dazu, wird dieses Fenster enger. Das System verliert die Balance und kippt entweder in Übererregung (Angst, Panik, Unruhe, Reizbarkeit) oder in Untererregung (Erschöpfung, Leere, Erstarrung). In diesen Zuständen greifen unsere alten Schutzmuster automatisch und blitzschnell.
Rückzug, Anspannung, Erstarrung, übermäßiges Denken oder das Bedürfnis, sich in die Obhut anderer zu begeben – all das sind Versuche, wieder innerhalb des Fensters zu landen, also Sicherheit herzustellen. Das ist kein Rückfall, sondern ein Hinweis auf etwas Ungelöstes: einen früheren Zustand, in dem niemand da war, um uns zu beruhigen, zu halten, zu zeigen, dass wir sicher sind und nicht allein. Der Körper erinnert sich an diese frühere Überforderung.
Heute kannst du diese Erinnerungen neu verknüpfen, indem du lernst, die Zeichen in deinem Körper wahrzunehmen und deinen Körper zu beruhigen. Mit jedem Mal, wenn du dich selbst in schwierigen Momenten regulierst, weitest du dein inneres Fenster und gewinnst Stück für Stück mehr Spielraum zwischen Reiz und Reaktion.
Angst oder Panik? Der feine Unterschied
Angst und Panik fühlen sich beide bedrohlich an und zeigen gleiche körperliche Anzeichen: starkes Herzklopfen, Enge, Schwindel, Kontrollverlust. Beides aktiviert das gleiche Stresssystem, doch der Unterschied liegt in Intensität und Kontrolle: Angst lässt sich meist noch benennen oder beobachten, sie entsteht oft aus Gedanken oder Sorgen. Angst ist eine Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung. Sie kann sich plötzlich zeigen (in einem Schreckmoment) oder langsam aufbauen, rational erscheinen und uns im Denken festhalten. Die Angst sagt: „Etwas stimmt nicht – pass auf.“
Panik dagegen überflutet unser ganzes System, ist wie eine körperliche Überschwemmung. Sie kommt plötzlich, ohne logischen Zusammenhang, und schreit: „Gefahr – rette dich!“ In der Panik ist kein Denken mehr möglich, weil der präfrontale Cortex, der Teil, der reflektieren und bewerten kann, praktisch abgeschaltet wird. Deshalb hilft es in diesen Momenten nicht, sich „zusammenzureißen“ oder „rational zu bleiben“. Der Körper braucht dann Beruhigung und keine Argumente.
Viele Menschen verwechseln beides, weil die körperlichen Symptome ähnlich sind. Und weil wir selten lernen, zwischen Anspannung und Überflutung zu unterscheiden. Für traumatisierte Nervensysteme verschwimmen diese Grenzen besonders leicht: Schon ein mittlerer Stresspegel kann sich anfühlen wie Panik, wenn der Körper keine Erfahrung mit Sicherheit gespeichert hat.
Wie du Angst bewältigen und Panik beruhigen kannst
Der Weg aus der Angst führt über Bewusstheit. Angst entsteht oft, weil der Kopf versucht, die Unruhe im Körper zu erklären. Er sucht nach Gründen, will verstehen, will Kontrolle gewinnen. Doch viele dieser Gedanken sind Deutungen und keine Tatsachen. Hier kann es hilfreich sein, deine Gedanken zu hinterfragen, ohne sie sofort zu glauben. Wenn du merkst, dass du dich in Szenarien verlierst, kannst du dir innerlich sagen: „Das ist nur ein Gedanke, so muss es nicht sein.“ Du kannst auch versuchen, den Gedanken zu verändern, Alternativen zu finden. Statt zu denken „Das ist so und kann nur so (gemeint) sein“, könntest du dich fragen: „Wie kann ich das noch verstehen?“ Dieses Vorgehen öffnet einen kleinen, aber entscheidenden Spalt zwischen dir und der Angst. Er schafft Distanz zwischen dem, was du denkst, und dem, was tatsächlich geschieht. In diesem Zwischenraum kannst du den Körper wieder mitnehmen: atme, bewege dich, schreibe, spüre dich. Manchmal reicht es, die Füße zu bewegen oder dich bewusst zu dehnen, um das Denken zu unterbrechen. Denn solange du im Körper bist, bist du im Jetzt.
Der Weg aus der Panik ist ein körperlicher Weg. Hier hilft keine Analyse, kein inneres Gespräch, kein Versuch, sie „wegzudenken“. Panik will nicht verstanden, sondern gehalten werden. Deshalb fokussiere dich auf deinen Körper. Spüre den Boden unter deinen Füßen. Such dir etwas, das dir Halt gibt, eine Wand, einen Tisch oder deine eigene Hand auf dem Herz. Lass deinen Atem kommen und gehen, ohne ihn zu steuern. Wenn es möglich ist, atme langsam durch den Mund aus, länger als du einatmest. Oder benenne, was du siehst: einen Stuhl, ein Fenster, Licht, Schatten. Das nennt man Orientierung im Raum. Sie sagt deinem Körper: Die Gefahr ist vorbei.
Die Panik lässt nach, wenn der Körper merkt, dass er wieder atmen darf, während die Angst sich beruhigt, wenn der Verstand erkennt, dass sie aus alten Annahmen kommt, nicht aus der Gegenwart. Beide Wege führen zur selben Tür: zurück in die Verbindung mit dir, dem Jetzt und deiner Umgebung.
Du musst deine Angst nicht allein tragen
Lass uns herausfinden, was dir Halt gibt
Vielleicht ist jetzt der Moment, an dem du dir erlauben darfst, nicht mehr alles allein zu halten. Ich begleite dich auf deinem Weg zu mehr innerer Ruhe, Sicherheit und Vertrauen in dich selbst.
Hier kannst du ein kostenfreies Kennenlerngespräch vereinbaren
Herzliche Grüße


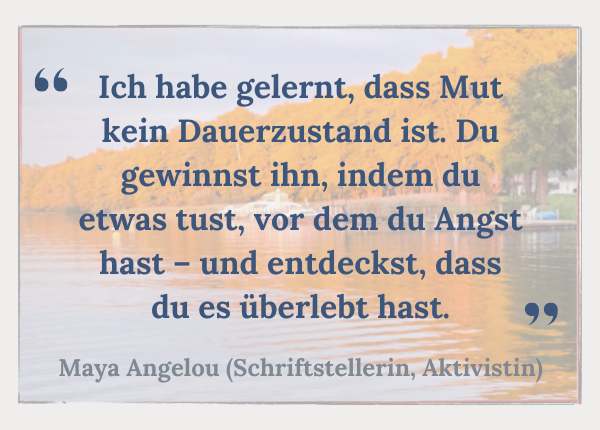
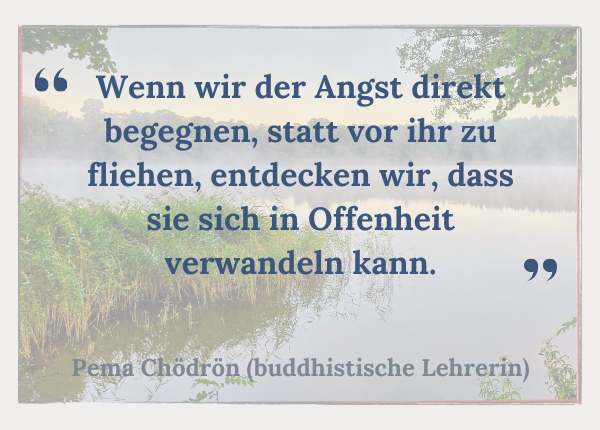
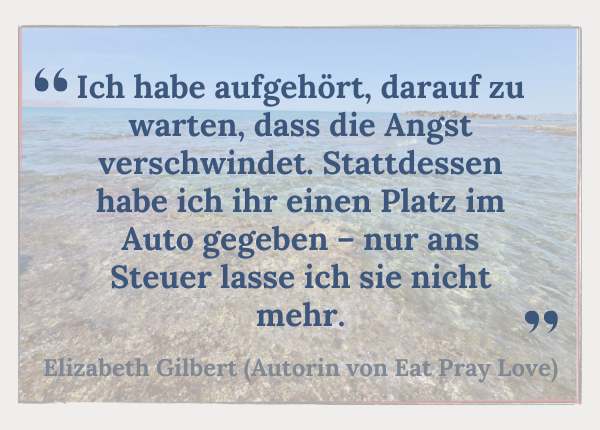






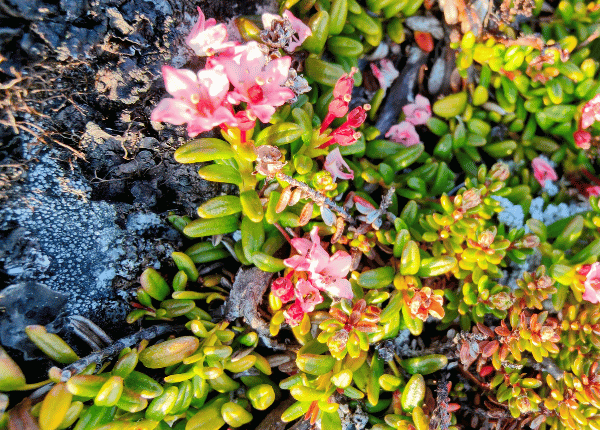

Hinterlasse einen Kommentar