Wenn das Elternhaus zur Falle wird – Wie Kindheitsverletzungen auch bei liebevollen Eltern entstehen
Ein liebevolles Elternhaus schließt Kindheitsverletzungen nicht aus. In meinen Coachings begegne ich immer wieder Menschen, die auf die Frage nach der Beziehung zu ihren Eltern fast reflexartig sagen: „Ich hatte eine schöne Kindheit.“ Sie beschreiben liebevolle Eltern, keine Gewalt, keine großen Dramen, und doch spüren sie eine innere Leere, chronische Überforderung oder das Gefühl, fremd im eigenen Leben zu sein.
Wie passt das zusammen? Diese Frage berührt einen wunden Punkt in der Selbstwahrnehmung vieler Menschen, die in einem sogenannten „funktionierenden“ Elternhaus aufgewachsen sind und trotzdem emotionale Kindheitsverletzungen in sich tragen.
Ich kenne diesen Zwiespalt gut: Auch mein eigener Weg bestand darin, beides anzuerkennen, die Gewalt, die ich erlebt habe, und das, was meine Eltern mir trotzdem mitgegeben haben. Dankbarkeit und Schmerz schließen sich nicht aus; sie gehören zur gleichen Bewegung des Erwachsenwerdens. In ihrer Tiefe ist der Lernweg oft derselbe: hinzuschauen, ohne zu verurteilen, und das eigene Leben nicht länger an den Grenzen der Vergangenheit auszurichten.
Wer sich diesem Prozess stellt, verlässt den Weg der Anpassung und kann beginnen, ein Leben zu führen, das Ausdruck der eigenen inneren Wahrheit wird.
Was vielleicht fehlte, obwohl alles gut war
Manchmal sind es nicht Schläge oder Schreie, die Spuren, als Kindheitsverletzungen, hinterlassen, sondern das, was fehlte:
echtes Gesehenwerden, emotionale Resonanz oder ein sicherer Raum für das, was wir wirklich fühlten.
Auch ohne Gewalt oder Vernachlässigung können folgende Muster entstehen:
⇒ Perfektionismus
„Ich darf keine Fehler machen, sonst enttäusche ich andere.“
⇒ Überanpassung
„Ich muss spüren, was andere brauchen, meine eigenen Gefühle sind zweitrangig.“
⇒ Schwierigkeiten mit Nähe
„Ich sehne mich nach Verbindung, aber sie fühlt sich bedrohlich an.“
⇒ Schuldgefühle für eigene Bedürfnisse
„Meine Eltern haben alles gegeben, ich darf mich nicht beklagen.“
⇒ Unfähigkeit, Wut oder Trauer zuzulassen
„Lieber herunterschlucken, denn negative Gefühle stören die Harmonie.“
Diese Muster sind keine Beweise gegen die Eltern, sondern Hinweise darauf, wo emotionale Bedürfnisse unerfüllt blieben.
Veränderung beginnt, wenn wir diese Muster erkennen.
Was dich in diesem Beitrag erwartet:
- Gute Absicht ist nicht gleich gesunde Wirkung
- Die Falle des „Es war doch alles gut“
- Was passiert, wenn du dir deine Kindheitsverletzungen nicht eingestehst?
- Wie du deine Geschichte anschauen kannst, ohne die innere Sicherheit zu verlieren
- Was es wirklich braucht: Differenzierung und Mitgefühl
- Fazit: Entwicklung braucht Ehrlichkeit, nicht Anklage
Gute Absicht ist nicht gleich gesunde Wirkung
Viele Eltern handeln aus bestem Wissen und Gewissen. Sie lieben ihre Kinder, sie versorgen sie, sie wollen das Beste für sie. Doch das bedeutet leider nicht automatisch, dass sie die emotionalen Bedürfnisse ihrer Kinder wirklich gesehen und beantwortet haben. Genau in diesem Raum zwischen Anspruch, Wille und eigenem Vermögen entstehen Kindheitsverletzungen, die sich erst im Erwachsenenalter zeigen. Denn unsere Eltern können nur weitergeben, was sie selbst erfahren und bestenfalls bewältigt haben.
Beispiele für unsichtbare emotionale Verletzungen:
- Kinder, die „brav“ sein mussten, um die Harmonie zu wahren, etwa weil Streit vermieden wurde oder ein Elternteil sehr empfindlich auf Emotionen reagierte.
- Eltern, die zwar körperlich präsent, aber emotional nicht erreichbar waren, z. B. weil sie selbst überfordert, depressiv oder in ständiger Betriebsamkeit gefangen waren.
- Eine subtile Erwartung, das Kind solle glücklich sein, damit sich die Eltern gut fühlen, deutlich gemacht durch Ermahnungen wie: „Jetzt sei doch nicht traurig, du hast doch alles!“
- Familien, in denen Leistung gleich Liebe bedeutete: Nur wer gute Noten schrieb oder sich besonders hilfsbereit verhielt, erhielt Zuwendung.
- „Wir haben doch immer alles für dich gemacht“ als Reaktion auf kritische Fragen, was das Kind dazu bringt, die eigenen Bedürfnisse und Erinnerungen zu unterdrücken.
Diese Erfahrungen führen nicht zu einem offensichtlichen Trauma, sondern zu subtilen Überzeugungen und Glaubenssätzen wie:
- „Ich darf keine Last sein.“
- „Ich muss stark sein und alles allein schaffen.“
- „Ich bin nur liebenswert, wenn ich leiste.“
Die Folge davon ist häufig ein Leben in chronischer Selbstüberforderung, emotionaler Abgeschnittenheit oder einer tiefen inneren Unruhe. All dies sind Spuren früher Verletzungen aus der Kindheit, die nie bewusst betrauert wurden. Die dahinterliegenden Bedürfnisse verbergen sich bis heute.
Hintergrund
Viele unserer Eltern und Großeltern wuchsen mit den Vorstellungen der sogenannten schwarzen Pädagogik auf, einer Erziehung, die Gehorsam über Gefühle stellte. Liebe war oft an Leistung oder Anpassung gebunden. Das prägt Erziehung bis heute, selbst dort, wo Zuwendung vorhanden war.
Erst in den letzten Jahrzehnten begann ein kollektives Umlernen: Gefühle dürfen wieder Raum bekommen und mit ihnen das Mitgefühl für das verletzte Kind in uns.
Die Falle des „Es war doch alles gut“
Sich den Wurzeln unserer Empfindungen anzunähern, löst in manchen Menschen fast panische Abwehr aus. Denn gerade weil das Elternhaus liebevoll war, entsteht ein innerer Konflikt: „Wie kann ich etwas infrage stellen, das objektiv gut war?“ Viele Menschen befürchten, undankbar oder illoyal zu wirken, wenn sie hinschauen, wo es ihnen als Kind an emotionaler Resonanz fehlte. Sie haben Angst, die Beziehung zu den Eltern zu gefährden, oder das vertraute Bild ihrer Kindheit zu verlieren. Denn dieses Bild war oft ein innerer Anker, wurde zu einer Geschichte, die Sicherheit gab: Ich hatte es gut.
Doch wenn innere Leere, Selbstzweifel oder unerklärliche Scham auftauchen, bricht etwas an dieser Erzählung auf. Es ist nicht der Wunsch, Schuldige zu finden, sondern die Idee entsteht, dass Liebe allein nicht immer reicht. Diese Ambivalenz auszuhalten – die Gleichzeitigkeit von Zuneigung und Schmerz – ist schwer. Und genau das verhindert oft, dass wir unsere Kindheitsverletzungen überhaupt erkennen.
Typische Widerstände gegen das Erkennen:
- Loyalität: Viele Menschen empfinden es als Verrat, sich kritisch mit den eigenen Eltern auseinanderzusetzen.
- Vergleich: „Andere hatten es doch viel schlimmer“ relativiert die eigenen Gefühle.
- Schuldgefühle: Der Gedanke „Ich dürfte mich eigentlich nicht beschweren“ blockiert ehrliche Selbstwahrnehmung.
- Angst vor Konsequenzen: Wer die eigene Geschichte hinterfragt, riskiert innere Instabilität oder familiäre Konflikte.
- Verlust der Identität: Das Bild der „heilen Kindheit“ gibt inneren Halt, bis es brüchig wird.
Die Ambivalenz zwischen „Meine Eltern haben ihr Bestes gegeben“ und „Es hat mir trotzdem geschadet“ ist schmerzhaft, aber notwendig, um Kindheitsverletzungen zu verstehen. Es geht nicht um die Verteilung von Schuld an die Eltern, es geht um die Wahrnehmung des eigenen Schmerzes und der eigenen Bedürfnisse.
Erklärung
Transgenerationale Weitergabe von Trauma bedeutet, dass unverarbeitete Erfahrungen – wie Angst, Scham oder emotionale Kälte – unbewusst an die nächste Generation weitergegeben werden. Nicht durch Worte, sondern durch Verhaltensmuster, Glaubenssätze und die Art, wie Nähe und/oder Sicherheit erlebt werden. Das hat Auswirkungen auf unsere Beziehungsmuster, unser Bindungsverhalten und unsere Körpersprache.
Was passiert, wenn du dir deine Kindheitsverletzungen nicht eingestehst?
Wer die eigenen Prägungen verdrängt, bleibt in alten Mustern gefangen, oft ohne es zu merken. Dein System wiederholt, was einst nötig war, um dazugehören oder überleben zu können: Du bleibst still, obwohl alles in dir brüllt, du funktionierst und lächelst, obwohl es sich wie Verrat anfühlt. Vielleicht musstest du früh Verantwortung übernehmen, Konflikte schlichten oder deine Gefühle verstecken, um geliebt zu bleiben.
Diese Dynamiken zeigen sich auf verschiedenen Wegen, beispielsweise in:
- Beziehungen, wenn du Nähe einerseits ersehnst, sie andererseits aber kaum aushältst. Wenn ein Teil von dir immer auf Abstand geht, sobald dich jemand wirklich sieht, oder du dich nur sicher fühlst, solange du gebraucht wirst.
- einem Gefühl von Leere oder Getriebenheit, die auch Erfolg, Anerkennung oder ein voller Terminkalender nicht füllen.
- der Abwehr gegen Konflikte, weil du Kritik sofort als Gefahr empfindest. Statt Grenzen zu setzen, ziehst du dich zurück oder passt dich an, aus Angst, verlassen oder beschämt zu werden.
- Selbstentwertung oder Überanpassung, wenn du dich über Leistung definierst oder ständig auf andere Rücksicht nimmst, um bloß niemanden zu enttäuschen.
- Erschöpfung und psychosomatischen Symptomen, wenn dein inneres System dauerhaft im Alarmzustand bleibt. Schlaflosigkeit, Verspannungen oder diffuse Schmerzen – dein Körper sagt dir, was die Psyche noch nicht sagen darf.
Unerkannte Kindheitsverletzungen bleiben nicht in der Vergangenheit. Sie schreiben sich in dein Nervensystem, deine Bindungsmuster und dein Selbstbild ein. Erst wenn du sie anerkennst, kannst du aufhören, sie unbewusst zu wiederholen. Dann öffnen sich dir neue Wege, in deinen Beziehungen, in der Arbeit, im Umgang mit deinen Kindern und mit dir selbst.
Wie du deine Geschichte anschauen kannst, ohne die innere Sicherheit zu verlieren
Viele Menschen scheuen sich davor, die eigene Kindheit zu hinterfragen. Nicht, weil sie die Wahrheit vermeiden wollen, sondern weil sie fürchten, dabei das Fundament zu verlieren, das sie bislang getragen hat. Denn wenn du anerkennst, dass auch in deiner liebevollen Familie Verletzungen entstanden sind, spürst du erst einmal Verunsicherung: War dann alles eine Lüge? Habe ich zu hohe Ansprüche? Doch genau diese Unsicherheit ist kein Absturz, sondern sie ist ein Übergang. Wenn du dich deinen Kindheitsverletzungen achtsam näherst, gewinnst du langfristig mehr Boden unter den Füßen, weil du lernst, dich selbst zu halten, statt dich weiter auf alte beruhigende Geschichten zu stützen.
Was dir auf diesem Weg hilft:
- Erlaubnis für Ambivalenz: Du darfst liebevoll aufgewachsen und verletzt worden sein. Diese beiden Wahrheiten schließen sich nicht aus. Vielleicht gab es Wärme, aber keine wirkliche Resonanz. Oder Zuwendung, aber keine Sicherheit. Erst wenn beides nebeneinanderstehen darf, beginnt Veränderung.
- Schrittweise Annäherung: Deine Wahrheit zeigt sich in kleinen Momenten, in einem Satz, einem Geruch, einer Erinnerung, die plötzlich Sinn ergibt. Es reicht, diese Splitter wahrzunehmen, ohne gleich etwas daraus machen zu müssen.
- Innere Ressourcen stärken: Auseinandersetzung braucht Gegengewicht. Routinen, Natur, Bewegung, Musik, kreative Ausdrucksformen oder Menschen, die dich nicht bewerten, sind deine Stützen. Sie erinnern dich daran, dass du heute erwachsen bist und selbst wählen kannst, wie viel Auseinandersetzung du zulässt.
- Realistische Erwartungen: Es geht nicht darum, deine Eltern zu entlarven oder die Beziehung zu ihnen zu zerstören. Es geht darum, deine eigene Wahrnehmung und dich selbst ernst zu nehmen.
Wenn das Nachdenken allein zu eng wird
Im Gespräch entsteht Klarheit
Die Auseinandersetzung mit den eigenen Kindheitsverletzungen
kann Fragen und Unsicherheiten wecken.
In einem kostenfreien Kennenlerngespräch schauen wir gemeinsam,
ob und wie ich dich in deinem Prozess begleiten kann.
Buche dir hier einen Termin.
Herzliche Grüße
Innere Sicherheit wächst aus Vertrauen
Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und in deine Fähigkeit, Gefühle zu halten, ohne daran zu zerbrechen.
So stärkst du dieses Vertrauen:
⇒ Nimm wahr, statt zu bewerten: Wenn du spürst, dass etwas in dir reagiert, ein Ziehen im Bauch, ein Druck im Hals, eine plötzliche Müdigkeit, dann nimm das an. Halte kurz inne. Atme. Sag dir innerlich: „Ah, so fühlt sich das an.“ Urteile nicht, nimm nur wahr und bleib im Kontakt mit deinem Körper.
⇒ Dosiere deine Gefühle: Du musst nicht alles auf einmal fühlen. Wenn etwas zu groß wird, lenk dich ab, bewege dich, geh ins Licht. Es geht nicht ums Aushalten, sondern ums Regulieren, also um den Rhythmus zwischen Nähe und Abstand und um die Pause zwischen Reiz und Reaktion.
⇒ Übe Selbstverbindung: Mach regelmäßig etwas, das dich spüren lässt, dass du da bist: Tanzen, dehnen, schreiben, singen, atmen. Je öfter du dich körperlich verankerst, desto vertrauter wird dir dein Körper und damit dein inneres Empfinden.
⇒ Teile deine Wahrheit: Sprich mit Menschen, die nicht über dich und das, was du sagst, urteilen. Menschen, die dir zuhören und dich fragen, bevor sie etwas zu dem Gehörten sagen. Sprich laut aus, was du fühlst. Worte geben dem eine Form, was vorher nur diffus in dir spürbar war.
⇒ Betrachte dich mit Milde: Wenn du merkst, dass du wieder in alte Muster fällst, halte inne. Sieh nicht nur den Fehler, sondern den Versuch, der sich dahinter verbirgt: den Versuch, dich zu schützen, geliebt zu bleiben und sicher zu sein. Nimm dich selbst in den Arm und spüre die Wärme an den Stellen, wo deine Haut auf deine Haut trifft.
Was es wirklich braucht: Differenzierung und Mitgefühl
Wachstum in diesem Zusammenhang bedeutet nicht, „über deine Vergangenheit hinwegzukommen“, sondern in ein reiferes Verständnis von dir selbst hineinzuwachsen. Es ist der Moment, in dem du aufhörst, deine Eltern zu idealisieren oder zu verurteilen, und in dem du beginnst, die ganze Geschichte zu sehen. Die Liebe, die da war. Und das, was dir fehlte.
Wachstum heißt auch, dass du die Verantwortung übernimmst für das Heute, ohne das Gestern zu leugnen. Es bedeutet, deine Kindheitsverletzungen anzuerkennen, ohne Schuldige zu suchen, und Mitgefühl zu entwickeln für alle Beteiligten. Nicht, weil alles entschuldbar wäre, sondern weil Verstehen Frieden schafft, wo Anklage nur Stillstand bringt.
Wie dieser Prozess aussehen kann:
- Nimm deine Bedürfnisse ernst:
Frage dich: Welche Bedürfnisse blieben in deiner Kindheit unerfüllt? Vielleicht wolltest du gesehen, verstanden, beschützt oder einfach in Ruhe gelassen werden. Diese Bedürfnisse leben weiter in dir. Sie zu erkennen und anzunehmen, ist kein Rückfall ins Kindliche, sondern dient deiner Selbstfürsorge. - Übernimm Verantwortung:
Du darfst anerkennen, was war, ohne zu verurteilen. Deine Eltern trugen ihre eigenen Wunden, ihre eigenen Begrenzungen. Verantwortung übernehmen heißt: Du akzeptierst, dass alles so war, wie es war, und du entscheidest, wie du heute mit dem Erbe deiner Kindheit umgehst, nicht mehr aus dem Gefühl der Ohnmacht heraus, sondern aus Bewusstsein. - Entwickle Mitgefühl für beide Seiten:
Mitgefühl ist kein Freispruch, sondern ein Perspektivwechsel. Wenn du deine Eltern als Menschen mit Geschichte siehst, löst sich das Schwarz-Weiß deiner Sicht auf sie. Du darfst traurig sein über das, was gefehlt hat, und gleichzeitig dankbar für das, was möglich war.
Diese Differenzierung ist kein leichter Prozess. Aber sie führt zu echter Selbstverbindung und zu einem klaren, mitfühlenden Blick auf dich selbst. Wachstum bedeutet in diesem Zusammenhang: Du bist nicht länger das Kind deiner Vergangenheit, sondern Gestalter:in deiner Gegenwart.
Fazit: Entwicklung braucht Ehrlichkeit, nicht Anklage
Vielleicht ist die Erkenntnis für dich nicht leicht zu tragen, dass ein liebevolles Elternhaus Kindheitsverletzungen nicht ausschließt. In deiner Auseinandersetzung mit dem Thema kommt unweigerlich der Moment, in dem dir klar wird: Deine Eltern sind die, die sie sind. Sie werden sich nicht ändern. Nicht, weil du zu wenig versucht hättest, sondern weil es nie in deiner Hand lag. Vielleicht wollen sie nicht oder können sie nicht. Oder ihre Schutzmechanismen sind zu stark und zu groß ist die Angst, am Schmerz der Vergangenheit zu zerbrechen.
Was dir bleibt, ist das Hinsehen. Hör auf, um etwas zu bitten, das nie kommen wird. Nimm dich selbst ernst und lebe, wie es dir entspricht. Dafür musst du dich weder rechtfertigen, noch deinen Eltern die Schuld zuweisen. Bist du an diesem Punkt, beginnt die Veränderung: nicht, weil jemand endlich anders wird, sondern weil du dich selbst nicht länger verlässt.
Beginne, deine Geschichte in kleinen Schritten zu erkunden.
Ich begleite dich gern dabei, einen sicheren Raum in dir zu finden – für das, was war, und das, was werden darf.
Vereinbare jetzt dein unverbindliches Kennenlerngespräch und finde heraus, was jenseits der Vergangenheit für dich möglich ist.









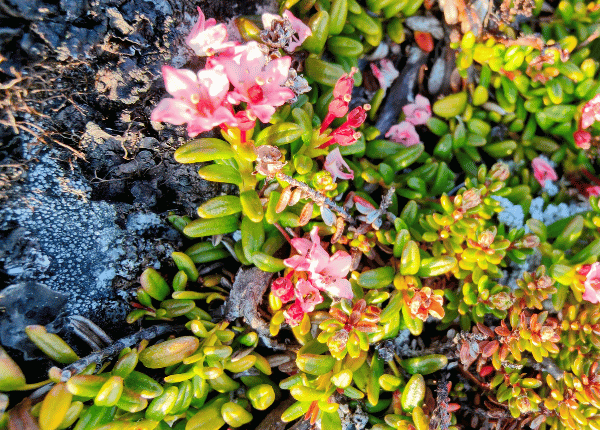

Liebe Barbara, vielen Dank für deine wertschätzende Rückmeldung. Deine Erfahrung deckt sich mit dem, was mir in meiner Arbeit immer wieder begegnet. Nur das Motto „Wenn du schon da bist, dann setze dich in ein Winkelchen und mach keine Brösel.“ lese ich hier zum ersten Mal. Hört sich ja erst einmal sehr freundlich an, in der Verniedlichungsform des „Winkelchens“, aber der Befehl „Mach keine Brösel“ heißt ja übersetzt: „Sei unsichtbar, atme nicht zu laut, nimm keinen Raum ein“. Was für eine Kind- und Lebendigkeitsfeindliche Einstellung. Danke dir fürs teilen! Gerzliche Grüße Sylvia
Liebe Sylvia!
Was für ein bewegender Artikel! Wenn scheinbar „alles gut war“ und doch so viel Schmerz entstanden ist, kann genauso herausfordernd, wie eine „schwierige“ Kindheit sein. Meine Freundin war ein Einzelkind, ich bin mit 8 Geschwistern groß geworden, unsere Kindheitserfahrungen sind erstaunlich ähnlich. Unser beider Kindheit war von Einsamkeitsgefühlen geprägt, so nach dem Motto: „Wenn du schon da bist, dann setze dich in ein Winkelchen und mach keine Brösel.“
Vielen Dank für deinen Wertvollen Artikel!
Herzlichst, Barbara
Liebe Pia, ich freue mich sehr über deinen Kommentar und fühle mich in meinem Anliegen sehr verstanden. In einem gebe ich dir vollkommen recht: „Dieses Erleben von Gleichzeitigkeit ist für mich einer der größten Gewinne überhaupt.“ Es hat eine lange Zeit bei mir gedauert, bis ich dazu in der Lage war, aber heute sehe ich darin den fruchtbaren Boden für innere Gelassenheit. Ganz herzliche Grüße zu dir, Sylvia
Liebe Sylvia,
und wieder einmal ist dir ein zutiefst berührender, menschlicher Artikel gelungen, der hoffentlich viele, viele Leser*innen erreicht!
Du beschreibst so eindrücklich, wie es sein kann, in einem liebevollen Umfeld aufzuwachsen und dennoch innere Wunden zu tragen.
Deine Sprache ist wie immer zugleich klar und mitfühlend. Damit öffnest du einen Raum, in dem ich mich als Leserin berührt fühlen darf von dem, was war, ohne mich selbst dafür verurteilen zu müssen. Besonders stark finde ich deinen Satz: Gute Absicht ist nicht gleich gesunde Wirkung.
Was mich besonders beeindruckt: Du legst dar, wie Muster wie Perfektionismus, Überanpassung oder Unfähigkeit, eigene Bedürfnisse zuzulassen, oft Hinweise sind auf unbewusste Prägungen. Deine Arbeit lädt ein, nicht nur zu erkennen, was fehlte, sondern auch anzunehmen, was da war — Zuneigung, Fürsorge — und zugleich das eigene Erleben ernst zu nehmen. Dieses Erleben von Gleichzeitigkeit ist für mich einer der größten Gewinne überhaupt.
Danke, dass du mit deiner Klarheit und deinem Mitgefühl so vielen Menschen Mut machst, hinzusehen und gleichzeitig sich selbst anzunehmen.
Von Herzen
Pia
Liebe Dorothe, ich danke dir für deine Offenheit. Ja, ich glaube daran, dass der Frieden in mir sehr dazu beiträgt, dass auch mein Umfeld friedlicher wird. Leider ist es keine Garantie, dass die Menschen, mit denen wir uns am sehnlichsten wünschen, im Frieden zu sein, dann zu uns zurückfinden. Denn auch sie müssen ihren eigenen Weg in ihren Frieden finden. Doch ich persönlich habe die Erfahrung gemacht und dies auch bei Klient:innen erlebt, dass der innere Frieden, der entsteht, wirkt, weil wir in einer lebensbejahenden Energie leben und es dadurch viel leichter fällt, anderen den Raum und Abstand zu lassen, den sie brauchen. Dadurch sind dann die Begegnungen, die stattfinden, wirkliche Begegnungen und keine Kampfzonen mehr, in denen es um Anerkennung und Wahrgenommenwerden geht. Herzliche Grüße Sylvia
Liebe Sylvia,
herzlichen Dank für diesen klaren, wertschätzenden und sehr menschlichen Artikel. Er bringt wunderbar auf den Punkt, was ich in den letzten Jahren für mich erarbeiten und erkennen durfte.
Und es geht dann weiter mit der Erkenntnis, dass man selbst in der Elternrolle das Beste will und doch nicht immer geben konnte…
Milde und Mitgefühl, auch oder vielleicht vor allem für sich selbst, sowie Eigenverantwortung sind Schlüsselworte, die Veränderung ermöglichen.
Und ich hoffe sehr, dass du mit deiner Überzeugung Recht behältst, dass wir mit dem Frieden, den wir in uns selbst schaffen, auch Frieden um uns herum ermöglichen. Ein Gedanke, der mich ebenfalls motiviert dranzubleiben.
Danke für dein Wirken und Sichtbarmachen.
Herzliche Grüße
Dorothee